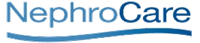Inhaltsverzeichnis
Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) bietet Patienten medizinische Versorgung unter einem Dach, von Hausärzten bis zu Fachspezialisten. Statt für jede Untersuchung eine neue Praxis aufzusuchen, können hier verschiedene Fachrichtungen eng zusammenarbeiten und Behandlungen besser koordinieren. Besonders in ländlichen Regionen trägt das MVZ dazu bei, die ambulante Versorgung sicherzustellen.
Doch wie genau funktioniert ein MVZ, wer arbeitet dort und welche Vor- und Nachteile gibt es? All das erklärt dieser Artikel.
Inhaltsverzeichnis
Was ist ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)?
Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) ist eine fachübergreifende ambulante Einrichtung, in der Ärzte verschiedener Fachrichtungen sowie weitere Gesundheitsberufe unter einem Dach zusammenarbeiten. Im Unterschied zu einer klassischen Einzelpraxis bietet ein MVZ die Möglichkeit, Patienten interdisziplinär und umfassend zu behandeln.
MVZs sind rechtlich als ärztlich geleitete Einrichtungen definiert und müssen mindestens zwei Vertragsärzte beschäftigen, die gemeinsam mindestens einen vollen Versorgungsauftrag erfüllen. Sie können sowohl von niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Kommunen oder anderen zugelassenen Trägern betrieben werden.
MVZs wurden 2004 mit dem GKV-Modernisierungsgesetz eingeführt, um die ambulante Versorgung flexibler zu gestalten. Seitdem gab es mehrere Gesetzesänderungen, um ihre Struktur, Trägerschaft und Abrechnungsmöglichkeiten zu regulieren.
MVZ in Zahlen
In Deutschland gibt es Stand Dezember 2023 rund 4.900 Medizinische Versorgungszentren, und ihre Zahl wächst kontinuierlich. Etwa die Hälfte wird von Krankenhäusern betrieben, während ein weiterer großer Teil in der Hand von vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen Trägerschaften liegt. Besonders im Bereich der hausärztlichen Versorgung, der Inneren Medizin und der Chirurgie und Orthopädie setzt man auf MVZs. Im Durchschnitt arbeiten etwa sechs Ärzte oder Psychotherapeuten in einem MVZ. Dieser Trend zeigt, dass MVZs eine immer größere Rolle in der ambulanten Versorgung spielen.
Medizinisches Versorgungszentrum – Aufgaben und Schwerpunkte
Ein Medizinisches Versorgungszentrum hat das Ziel, Patienten eine gut organisierte und fachübergreifende ambulante Versorgung zu bieten. Durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen lassen sich Diagnostik und Therapie besser koordinieren, was besonders bei chronischen Erkrankungen oder komplexen Krankheitsbildern von Vorteil ist.
Ein MVZ verfolgt mehrere Aufgaben, wovon eine die hausärztliche und fachärztliche Versorgung in einer gemeinsamen Einrichtung darstellt. Weiterhin setzen sich die Einrichtungen eine bessere Vernetzung medizinischer Leistungen als Ziel, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Die Verkürzung von Wartezeiten durch abgestimmte Terminvergabe und schnelle Überweisungen innerhalb des MVZ spielt ebenfalls eine große Rolle. Indem MVZs die ambulante Medizin in Gebieten mit Ärztemangel sicherstellen, verbessern sie zusätzlich die Versorgung in strukturschwachen Regionen. Außerdem entlasten sie Kliniken, indem sie ambulante Behandlungen übernehmen, die sonst möglicherweise im Krankenhaus durchgeführt würden.
MVZs können dabei unterschiedliche Schwerpunkte haben. Manche Zentren sind fachübergreifend aufgestellt und bieten ein breites Spektrum an medizinischen Leistungen, während andere sich auf bestimmte Fachgebiete wie Orthopädie, Kardiologie oder Onkologie spezialisieren.
Wer arbeitet in einem Medizinischen Versorgungszentrum?
In einem Medizinischen Versorgungszentrum arbeiten verschiedene medizinische Fachkräfte zusammen, um eine umfassende Patientenversorgung zu gewährleisten. Das interdisziplinäre Team setzt sich aus mehreren Berufsgruppen zusammen, die je nach Schwerpunkt des MVZs variieren können.
Ein MVZ muss mindestens zwei Fachärzte unterschiedlicher Disziplinen beschäftigen. Häufig sind dies Hausärzte, Internisten, Orthopäden, Kardiologen, Gynäkologen oder Neurologen. Die enge Zusammenarbeit zwischen diesen Fachrichtungen ermöglicht eine schnelle und gezielte Behandlung von Patienten mit komplexen Erkrankungen.
Medizinische Fachangestellte (MFA) übernehmen die Organisation des Praxisbetriebs, unterstützen die Ärzte bei Untersuchungen und sind die erste Anlaufstelle für Patienten. In manchen MVZs, insbesondere mit chirurgischem oder onkologischem Schwerpunkt, sind auch Pflegekräfte oder speziell ausgebildete Fachkräfte für Wundversorgung (Wundmanager) oder Infusionstherapien tätig.
Je nach Ausrichtung des MVZ können auch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder Logopäden Teil des Teams sein. Besonders in orthopädischen oder neurologischen MVZs sind solche Therapeuten wichtig, um Patienten nach Operationen oder bei chronischen Erkrankungen zu unterstützen.
Viele MVZs beschäftigen auch Sozialarbeiter, Psychologen oder Ernährungsberater, um Patienten eine ganzheitliche Betreuung anzubieten. Zudem sorgen Praxismanager und Verwaltungsmitarbeiter für einen reibungslosen Ablauf im Hintergrund, indem sie Terminmanagement, Abrechnung und Patientenorganisation übernehmen.
Medizinisches Versorgungszentrum – Vorteile
Für Patienten bietet ein Medizinisches Versorgungszentrum mehrere Vorteile gegenüber einer klassischen Einzelpraxis. Durch die Zusammenarbeit mehrerer Fachrichtungen profitieren sie von einer besseren Koordination der Behandlungen und kürzeren Wegen innerhalb der Einrichtung. Patienten müssen nicht eigenständig verschiedene Arztpraxen aufsuchen, sondern erhalten eine besser abgestimmte Diagnostik und Therapie.
Da mehrere Ärzte im MVZ tätig sind, lassen sich Termine zudem oft flexibler koordinieren. Das hat eine effizientere Behandlung zur Folge, weil Befunde schneller ausgetauscht und Doppeluntersuchungen vermieden werden.
In strukturschwachen Gebieten, in denen viele Arztpraxen schließen, tragen MVZs dazu bei, die medizinische Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Durch ihre Organisationsstruktur können sie auch dort Ärzte anstellen, wo sich eine Niederlassung als Einzelpraxis nicht mehr lohnt.
Im Gegensatz zu einer Gemeinschaftspraxis können sich Ärzte in einem MVZ anstellen lassen, wobei auch Teilzeit möglich ist. Diese Möglichkeit bietet durch flexible Arbeitsmodelle eine ausgewogene Work-Life-Balance. Durch die Anstellung vermeiden Ärzte zudem das finanzielle Risiko einer eigenen Praxis, zudem fällt weniger Bürokratie an. Junge Mediziner profitieren durch die Zusammenarbeit und können somit viel Berufserfahrung sammeln. Ein weiterer Vorteil ist die Reduktion der Kosten, denn im MVZ teilt man sich die Ressourcen. Somit ist weniger Budget für Räume, Bürokratie, Personal und Geräte nötig.
Medizinisches Versorgungszentrum – Nachteile
Trotz vieler Vorteile gibt es auch einige Nachteile, die Patienten in einem Medizinischen Versorgungszentrum beachten sollten. Diese betreffen vor allem die persönliche Arzt-Patienten-Beziehung sowie die Struktur und Organisation der Einrichtung. In einer Einzelpraxis behandelt oft derselbe Arzt über Jahre hinweg seine Patienten. In einem MVZ kann es hingegen vorkommen, dass Patienten nicht immer vom gleichen Arzt betreut werden, da je nach Verfügbarkeit verschiedene Ärzte die Sprechstunden übernehmen. Dies kann für Patienten, die viel Wert auf eine langfristige Arzt-Patienten-Bindung legen, ein Nachteil sein.
Während klassische Arztpraxen meist überschaubar und persönlich sind, kann ein MVZ durch seine Größe und Organisationsstruktur eher an eine kleine Klinik erinnern. Dies kann dazu führen, dass sich Patienten weniger individuell betreut fühlen oder die Abläufe als weniger persönlich empfinden.
Ein MVZ kann von verschiedenen Trägern betrieben werden, darunter Krankenhäuser, Kommunen oder private Investoren. In einigen Fällen kann dies dazu führen, dass wirtschaftliche Interessen eine größere Rolle spielen als in einer klassischen Arztpraxis. Außerdem sind Ärzte deshalb an die Vorgaben der Trägerschaft gebunden und können nicht so frei entscheiden, wie bei einer eigenen Praxis.
Kommerzielle Medizin?
Einige MVZs werden von Krankenhauskonzernen oder privaten Investoren betrieben, was zu einer Kommerzialisierung der ambulanten Versorgung führen kann. Kritiker befürchten, dass wirtschaftliche Interessen stärker in den Vordergrund rücken, etwa durch eine bevorzugte Behandlung lukrativer Patienten oder eine verstärkte Ausrichtung auf gewinnbringende Leistungen. Zudem könnten MVZ-Übernahmen durch Investoren dazu führen, dass kleinere, unabhängige Praxen verdrängt werden. Die Politik diskutiert daher über strengere Regulierungen, um sicherzustellen, dass medizinische Entscheidungen patientenorientiert und nicht profitgetrieben getroffen werden.
Medizinisches Versorgungszentrum – Gründung
Die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums unterliegt bestimmten rechtlichen und organisatorischen Vorgaben. Ein MVZ kann nicht von einzelnen Ärzten ohne Weiteres eröffnet werden, sondern benötigt eine Zulassung durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) sowie eine geeignete Trägerstruktur.
Laut Sozialgesetzbuch V (§ 95 SGB V) können folgende Träger ein MVZ betreiben:
- Vertragsärzte oder Arztgruppen
- Krankenhäuser
- Gemeinden und Kommunen
- Gemeinnützige Organisationen
- Private Investoren und Kapitalgesellschaften
Ein MVZ muss mindestens zwei Fachärzte unterschiedlicher Fachrichtungen beschäftigen, um die fachübergreifende Versorgung sicherzustellen. Die Zulassung erfolgt über die Kassenärztliche Vereinigung, die prüft, ob eine ausreichende Patientenversorgung gewährleistet ist. Zudem müssen geeignete Räumlichkeiten sowie ein tragfähiges Betriebskonzept vorliegen.
Die Gründung eines MVZ umfasst mehrere Schritte:
- Konzeptentwicklung und Planung: Hier legt man das medizinische Angebot und die Trägerstruktur fest.
- Antragstellung bei der Kassenärztlichen Vereinigung: Im Anschluss erfolgt die Prüfung der fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Voraussetzungen.
- Zulassung und Eintragung. Nach Genehmigung wird das MVZ als ärztlich geleitete Einrichtung registriert.
- Betriebsaufnahme: Hierfür stellt man Personal ein, nimmt den Aufbau der Infrastruktur in Angriff und startet die Patientenversorgung.
Ein MVZ kann sowohl neu gegründet als auch durch die Übernahme einer bestehenden Praxis entstehen. Gerade in strukturschwachen Regionen wird die Gründung oft staatlich gefördert, um die medizinische Versorgung sicherzustellen.
Rechtliche Grundlage
Medizinische Versorgungszentren sind im Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) § 95 geregelt. Sie gelten als ärztlich geleitete Einrichtungen, die ambulante medizinische Leistungen erbringen und an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Die meisten MVZs besitzen die Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), auch wenn weitere Formen möglich sind.
Die Rechtsform bestimmt juristische, wirtschaftliche und steuerrechtliche Vorgaben. Ist das MVZ beispielsweise als GmbH eingetragen, müssen die Bilanzpflicht und die Gewerbesteuerpflicht bedacht werden, anstatt der typischen Einnahmen-Überschuss-Rechnung in anderen Rechtsformen.
Neben den bereits genannten Voraussetzungen ist die ärztliche Unabhängigkeit eine weitere Bedingung, auch wenn ein nicht-medizinischer Träger das MVZ betreibt. Zudem unterliegen MVZs denselben Abrechnungs- und Qualitätsanforderungen wie Einzelpraxen.
Passende Jobs im MVZ
Auf der Suche nach einem Job in der Patientenversorgung? Bei Medi-Karriere gibt es zahlreiche Stellen als MFA, Jobs als Pflegefachkraft oder Stellenangebote als Physiotherapeut.
Häufige Fragen
- Wie funktioniert ein Medizinisches Versorgungszentrum?
- Was ist der Unterschied zwischen MVZ und Gemeinschaftspraxis?
- Was ist der Unterschied zwischen einem MVZ und einem Krankenhaus?
- Wer kann ein MVZ gründen?
Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) ist eine ambulante Einrichtung, in der Ärzte verschiedener Fachrichtungen gemeinsam arbeiten. Patienten profitieren davon, dass sie verschiedene medizinische Leistungen an einem Ort erhalten und Überweisungen innerhalb des MVZs schneller erfolgen. Die Abrechnung läuft über die Kassenärztliche Vereinigung, ähnlich wie bei Einzelpraxen. MVZs können von Ärzten, Krankenhäusern oder anderen zugelassenen Trägern betrieben werden und unterliegen den gleichen Qualitäts- und Abrechnungsanforderungen wie niedergelassene Praxen.
Der Hauptunterschied liegt in der organisatorischen Struktur. Eine Gemeinschaftspraxis wird von mehreren niedergelassenen Ärzten als Gemeinschaft betrieben, wobei sie gemeinsam abrechnen und wirtschaftlich verbunden sind. Ein MVZ hingegen ist eine ärztlich geleitete Einrichtung, die auch von Krankenhäusern, Kommunen oder Investoren gegründet werden kann. Ärzte in einem MVZ sind meist angestellt, während sie in einer Gemeinschaftspraxis als selbstständige Vertragsärzte tätig sind.
Ein MVZ bietet ausschließlich ambulante Behandlungen an, während ein Krankenhaus sowohl ambulante als auch stationäre Behandlungen durchführt. Während MVZs Teil der vertragsärztlichen Versorgung sind und über die Kassenärztliche Vereinigung abrechnen, erfolgt die Finanzierung von Krankenhäusern über Fallpauschalen und Budgets der Krankenkassen. Zudem sind Krankenhäuser meist größer, verfügen über Bettenstationen und bieten umfassendere medizinische Versorgungsstrukturen.
Laut § 95 SGB V können Vertragsärzte, Krankenhäuser, Kommunen, gemeinnützige Organisationen und private Investoren ein MVZ gründen. Voraussetzung ist, dass das MVZ mindestens zwei Fachärzte unterschiedlicher Fachrichtungen beschäftigt und eine Zulassung durch die Kassenärztliche Vereinigung erhält. Die Leitung muss durch einen Arzt erfolgen, um die medizinische Unabhängigkeit zu gewährleisten.
- Medizinische Versorgungszentren aktuell, https://www.kbv.de/... , (Abrufdatum: 14.03.2025)
- Medizinische Versorgungszentren, https://www.kbv.de/... , (Abrufdatum: 14.03.2025)
- Medizinische Versorgungszentren, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/... , (Abrufdatum: 14.03.2025)