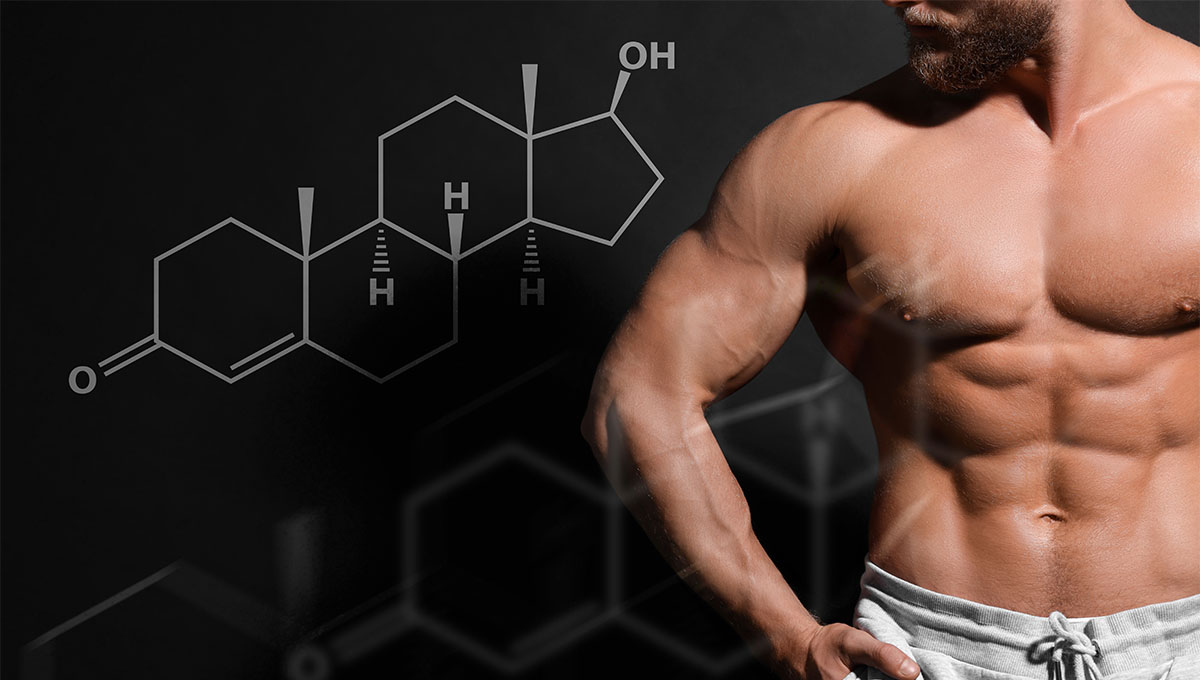Inhaltsverzeichnis
Steroidhormone steuern vereinfacht gedacht körpereigene Botenprozesse, die Energiehaushalt, Blutdruck, Fruchtbarkeit und Entzündungsreaktionen prägen. Dieser Artikel bündelt das Wesentliche zum Thema: Einordnung und Klassen, Synthese und Regulation, Transport und Wirkung sowie Abbau, Pharmakologie und Besonderheiten.
Inhaltsverzeichnis
Steroidhormone – Definition und Einordnung
Steroidhormone sind körpereigene Signalstoffe mit einem gemeinsamen, viergliedrigen Sterangerüst, chemisch das „Gonane“-Nukleus (vier zusammengewachsene Ringe) mit siebzehn Kohlenstoffen. Fachlich ordnet man sie nach Kohlenstoffzahl:
- C21 (Pregnane: Glucocorticoide, Mineralocorticoide, Progesteron)
- C19 (Androgene)
- C18 (Östrogene).
Diese Einteilung spiegelt den Zusammenhang von Struktur und Funktion.
Die wichtigsten Klassen sind näher betrachtet folgende:
- Glucocorticoide (zum Beispiel Cortisol)
- Mineralocorticoide (Aldosteron)
- Androgene (Testosteron)
- Östrogene (Estradiol)
- Gestagene (Progesteron)
In der Nebennierenrinde entstehen sie zonenspezifisch. In der Zona glomerulosa bilden Zellen die Mineralocorticoide, in der Zona fasciculata entstehen die Glucocorticoide und in der Zona reticularis die adrenalen Androgene. Gonaden synthetisieren vor allem Androgene, Östrogene und Progesteron. In der Schwangerschaft übernimmt zunehmend die Plazenta die Progesteron- und Östrogenproduktion.
Zur funktionellen Einordnung gehört auch die periphere Umwandlung. Testosteron dient als Prohormon und wird je nach Gewebe zu Dihydrotestosteron (DHT) über die 5-α-Reduktase oder Estradiol (E₂) über die Aromatase umgewandelt.
Steroidhormone – Biosynthese und Regulation
Alle Steroidhormone starten biochemisch beim Cholesterin. Die Zelle transportiert Cholesterin über StAR-Proteine in die Mitochondrien (Kraftwerke der Zelle). Das ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Dort spaltet das Enzym CYP11A1 die Seitenkette ab, wodurch Pregnenolon entsteht. Es dient als gemeinsamer Ausgangspunkt für alle späteren Abzweigungen zu Cortisol, Aldosteron, Androgenen und Östrogenen.
Wo welche Hormone entstehen, bestimmt das Enzym-Profil des Gewebes. Weil jede Zone der Nebennierenrinde andere Enzyme bildet, entstehen dort unterschiedliche Hormone. Vereinfacht gesagt entsteht in der vorderen Zone eher Aldosteron, in der mittleren eher Cortisol und in der hinteren eher adrenale Androgene. Gonaden bilden vor allem Androgene, Östrogene und Progesteron.
Regelkreise
Die Sekretion folgt klaren Regelkreisen. Cortisol steuert die HPA-Achse (Hypothalamus–Hypophyse–Nebenniere) über ACTH und zeigt einen ausgeprägten circadianen Rhythmus mit morgendlichem Maximum. Aldosteron reagiert vor allem auf das Renin–Angiotensin–Aldosteron-System (RAAS) und auf Serumkalium, während ACTH dabei nur eine Nebenrolle spielt. Die gonadalen Steroide reguliert die HPG-Achse (Hypothalamus–Hypophyse–Gonaden). Pulsatiles GnRH treibt die Ausschüttung von LH und FSH an und taktet so Pubertät, Zyklus und Fertilität.
Testosteron wird im Zielgewebe je nach Bedarf zu Dihydrotestosteron (DHT) über 5-α-Reduktase umgewandelt oder zu Estradiol über Aromatase umgebaut. So entstehen gewebespezifische Wirkprofile (zum Beispiel Prostata vs. Knochen).
Steroidhormone – Transport und Wirkmechanismen
Im Blut übernehmen vor allem drei Proteine den Transport der Steroidhormone: Albumin (Transporter) wirkt als universeller Träger mit niedriger Bindungsstärke, aber hoher Kapazität. Sex hormone-binding globulin (SHBG, Sexhormon-Binder) bindet Testosteron und Estradiol besonders stark. Corticosteroid-binding globulin (CBG, Transcortin; Cortisol-Binder) bindet Glukokortikoide und Progesteron mit hoher Affinität. Über diese Bindung steuern die Proteine den Gewebezugang, doch biologisch wirksam ist vor allem die freie, ungebundene Fraktion („free-hormone hypothesis“).
Wichtige Modulatoren dieser Transportproteine sind zum Beispiel Östrogene (etwa während der Schwangerschaft oder bei der kombinierten Pille). Sie erhöhen die Konzentration von CBG und SHBG. Eine Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion) geht typischerweise mit erhöhtem SHBG einher. Zusätzlich senken Insulinresistenz oder eine hohe Zuckerzufuhr die hepatische SHBG-Produktion. Diese Veränderungen verschieben Total- vs. freie Hormonspiegel und beeinflussen Laborbefunde.
Genomische Signalwege
Steroide binden intrazelluläre Nukleärrezeptoren wie GR (Glucocorticoid-Rezeptor), MR (Mineralocorticoid-Rezeptor), AR (Androgen-Rezeptor), ER (Östrogen-Rezeptor) oder PR (Progesteron-Rezeptor).
In Ruhe liegen viele dieser Rezeptoren als Hitzeschockprotein-Komplex (HSP90/HSP70; Chaperone) vor. Nach Ligandenbindung lösen sich die Chaperone, der Rezeptor dimerisiert, wandert in den Zellkern und bindet Hormone Response Elements (HREs) in der DNA. Dort aktiviert oder reprimiert er Zielgene. Zur antiinflammatorischen Wirkung trägt unter anderem die Transrepression von NF-κB (Entzündungs-Schalter) und AP-1 bei. Genomische Effekte treten innerhalb von Minuten bis Stunden auf.
Nicht-genomische Signalwege
Steroide können sekunden- bis minuten-schnell Signale auslösen, ohne direkt die Genexpression zu verändern. Das ist etwa bei Gefäß- oder Bronchialreaktionen notwendig. Beispiele hierfür sind etwa der G protein-coupled estrogen receptor, kurz GPER (membranständiger Östrogen-Sensor) und die raschen Glukokortikoid-Effekte über membranassoziierte oder zytosolische GR-Pools (etwa Modulation bronchialer Signalwege). Diese Wege nutzen Second Messenger (zum Beispiel cAMP, Ca²⁺/Kinasen) und ergänzen die klassischen Gen-Effekte.
Steroidhormone – Physiologie, Diagnostik und Klinik
Für die Befundinterpretation im Zusammenhang mit Steroidhormonen gilt, dass Zeitpunkt und Begleitmedikation den Hormonspiegel beeinflussen. Cortisol schwankt zirkadian (morgens höher), während Östrogene CBG/SHBG erhöhen, Hyperthyreose erhöht und Insulinresistenz senkt SHBG. Dadurch kann der Gesamtwert täuschen, die freie Fraktion ist klinisch maßgeblich.
Physiologisch sichern Glukokortikoide die Energiebereitstellung. Sie steigern die Glukoneogenese, hemmen die Glukoseaufnahme in periphere Gewebe, fördern Lipolyse und Proteinabbau und steigern somit die Substratbereitstellung. Zusätzlich unterdrücken sie Entzündungsreaktionen über genregulierte Mechanismen. Wenn zu viele Glukokortikoide vorhanden sind, spricht man vom Hyperkortisolismus (Cushing-Syndrom), beim Gegenteil von Hypokortisolismus (adrenale Insuffizienz).
Mineralokortikoide (Aldosteron) steuern die Na⁺-Rückresorption und K⁺-Ausscheidung in der Niere über rezeptorvermittelte Regulation von ENaC (epithelialer Na⁺-Kanal) und Na⁺/K⁺-ATPase. So stabilisiert es Volumen und Blutdruck. Beim primären Hyperaldosteronismus-Syndrom (PA) ist die Konzentration von Aldosteron erhöht. Damit stellt die Erkrankung eine wichtige Ursache für erhöhten Blutdruck dar.
Androgene, vor allem Testosteron und DHT, prägen die männliche Reproduktion. Dazu zählt insbesondere der Genitaltrakt, sekundäre Geschlechtsmerkmale und die Fertilität. Zusätzlich tragen sie zum anabolen Status von Gewebe bei. Klinisch relevant ist in diesem Zusammenhang der Männliche Hypogonadismus. Bei Frauen spielen Androgene eine Rolle beim weiblichen Hyperandrogenismus oder auch PCOS.
Östrogene fördern die Endometrium-Proliferation und unterstützen die Knochengesundheit. Ein Mangel (zum Beispiel postmenopausal) begünstigt Knochenverlust. Progesteron transformiert das Endometrium sekretorisch und dient damit der Einnistungs-Vorbereitung. Gleichzeitig antagonisiert es die reine Östrogen-Proliferation im Zyklus.
Falscher Steroidbefund?
Manche Situationen verfälschen Steroidwerte: Alkoholabusus, schwere Depression und ausgeprägte Adipositas können ein Cushing-ähnliches Muster erzeugen. Östrogene (Schwangerschaft, kombinierte Pille) erhöhen das Corticosteroid-binding Globulin. Dadurch steigt das Gesamt-Cortisol, während freies Cortisol oft unverändert bleibt. Zur Beurteilung eignen sich dann Speichel- oder Urin-Cortisol. Verschiebungen von SHBG/CBG, etwa SHBG↑ bei Hyperthyreose, SHBG↓ bei Insulinresistenz oder Proteinänderungen bei Leber- oder Nierenerkrankungen – lassen Gesamtwerte täuschen. Bei Androgenen ist deshalb die freie Fraktion aussagekräftiger als Gesamt-Testosteron. Exogene Steroide (Inhalativa, Cremes, „Supplements“) können Spiegel erhöhen oder Achsen dämpfen.
Pharmakologische Nutzung
Steroidhormone finden in vielen Medikamenten Anwendung. Ein Beispiel hierfür ist Ethinylestradiol (EE) in oralen Kontrazeptiva wie der Pille. EE ist für die orale Gabe optimiert. Die 17-alpha-Ethinylgruppe schützt vor rascher hepatischer Inaktivierung und erhöht die orale Wirksamkeit gegenüber natürlichem Estradiol (E₂). EE wird zwar gut aus dem Darm aufgenommen, die absolute Bioverfügbarkeit liegt aber typischerweise unter fünfzig Prozent und wird durch First-Pass-Metabolismus in Darmschleimhaut und Leber (etwa Konjugation zu Sulfaten/Glucuroniden) begrenzt. E₂ zeigt demgegenüber deutlich niedrigere systemische Verfügbarkeit bei oraler Gabe, was historisch seine Nutzung in klassischen Kombinationspillen begrenzte.
Ein weiteres Beispiel sind inhalative Glukokortikoide wie Budesonid. Nach Inhalation landet ein relevanter Anteil der Dosis im Mund-Rachen-Raum und wird geschluckt. Bei Wirkstoffen mit hoher hepatischer First-Pass-Clearance wird diese geschluckte Fraktion nahezu vollständig in der Leber inaktiviert. Genau dieses Profil besitzen Budesonid (orale Bioverfügbarkeit etwa zehn Prozent) und Fluticasonpropionat (orale Bioverfügbarkeit unter ein Prozent). Die klinische Systemexposition nach Inhalation stammt daher überwiegend aus der in der Lunge deponierten Fraktion. Starke CYP3A-Hemmer können jedoch die systemische ICS-Exposition erhöhen, weshalb man unbedingt Interaktionen zwischen Arzneimitteln prüfen muss.
Steroidhormone – Abbau und Metaboliten
Nach ihrer Wirkung wandelt die Leber Steroide in mehreren Schritten um. Phase I umfasst vor allem Reduktionen, zum Beispiel über 5-α/5-β-Reduktasen, 3-α/3-β-Hydroxysteroid-Dehydrogenasen, HSD, 17-β-HSD, und das 11-β-HSD-System (Cortisol ↔ Cortison). Dabei entstehen definierte Metabolitenmuster, beispielsweise aus Androgenen Androsteron und Etiocholanolon. Phase II macht sie wasserlöslich über die Glucuronidierung (vor allem über UDP-Glucuronosyltransferasen) und Sulfatierung (vorwiegend SULT2A1; Sulfotransferase). Die konjugierten Metabolite scheidet der Körper über Urin und Galle aus.
Östrogene werden in der Leber konjugiert, über die Galle in den Darm abgegeben und dort durch bakterielle β-Glucuronidasen dekonjugiert. Ein Teil wird wieder resorbiert und durchläuft somit den enterohepatischen Kreislauf. Das Mikrobiom-Genensemble für diesen Prozess nennt man „Estrobolome“. Veränderungen des Estroboloms modulieren zirkulierende Östrogenspiegel.
- Schiffer J et al., Human steroid biosynthesis, metabolism and excretion […], https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/... , (Abrufdatum: 17.08.2025)
- Handelsmann D et al., Androgen Physiology, Pharmacology, Use and Misuse, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/... , (Abrufdatum: 17.08.2025)
- Nicolaides N et. al., Adrenal Cortex, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/... , (Abrufdatum: 17.08.2025)
- Allgemeine Hormoneigenschaften, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 17.08.2025)