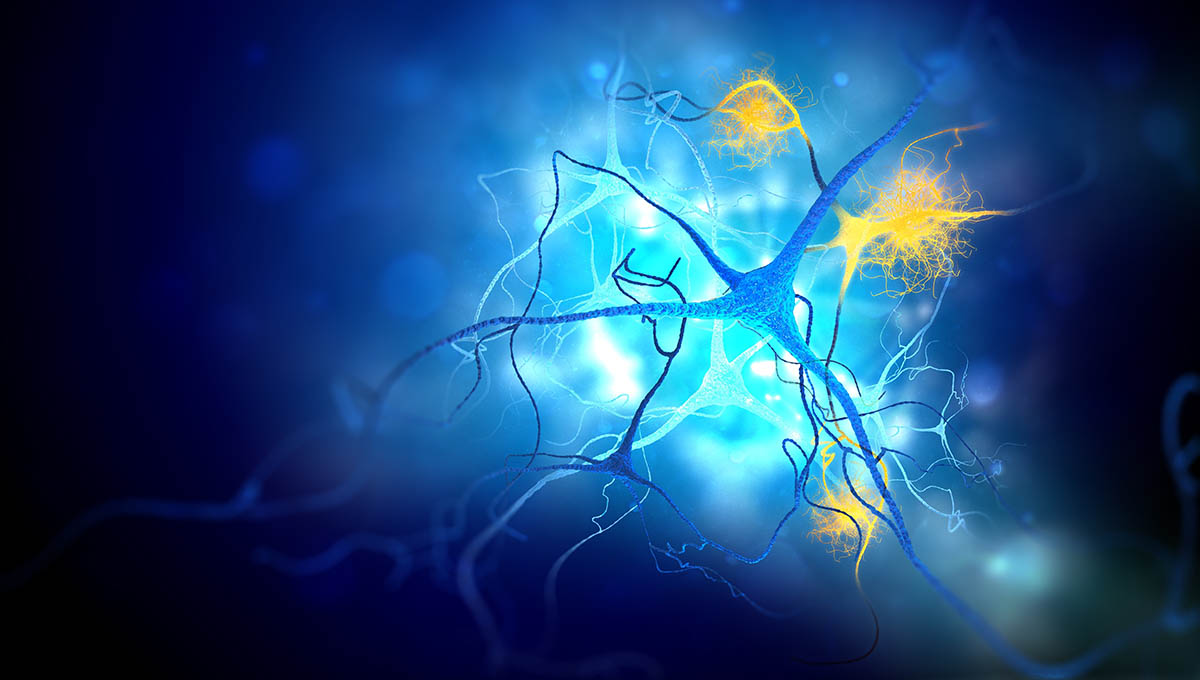Inhaltsverzeichnis
Gewebe sind ständigem Umbau ausgesetzt, bei dem des auch zur Atrophie kommen kann. Diese ist im Gegensatz zur Hypertrophie durch Abnahme des Gewebes gekennzeichnet. In diesem Artikel soll ein Blick auf die Bedeutung, Funktion und den klinischen Zusammenhang von atrophierenden Geweben geworfen werden.
Inhaltsverzeichnis
Atrophie – Definition
Das Verkleinern eines Organs und Gewebes nennt man Atrophie. In atrophischen Geweben verringert sich die Zellzahl, es kann aber auch zur Abnahme der Größe von Zellen kommen.
Atrophie – Funktion
Atrophie tritt auf, wenn Zellen aufgrund von mangelnder Nutzung, Durchblutungsstörungen, Unterernährung, hormonellen Veränderungen oder Krankheiten ihre normale Funktion nicht mehr aufrechterhalten können. Die Funktion der Atrophie besteht dabei in gewisser Weise in einer Anpassung des Körpers an veränderte Bedingungen – etwa durch Reduktion des Energieverbrauchs in nicht mehr ausreichend versorgten Geweben. Allerdings kann eine fortschreitende Atrophie auch zu funktionellen Einschränkungen führen, beispielsweise bei Muskelschwund infolge längerer Immobilität.
Atrophie und Alter
Mit zunehmendem Alter kommt es ganz natürlich zu verschiedenen atrophischen Prozessen im Körper – das heißt, bestimmte Gewebe und Organe schrumpfen oder verlieren an Funktion, ohne dass zwingend eine Krankheit vorliegt.
Atrophie – Klinik
Allgemein zeigt sich Atrophie durch eine Größenabnahme des betroffenen Organs oder Gewebes, was oft mit einem Funktionsverlust verbunden ist. Bei Muskelatrophie beispielsweise kommt es zu Kraftverlust, Bewegungseinschränkungen und im fortgeschrittenen Stadium auch zu Muskelschmerzen oder Krämpfen. In anderen Organen, etwa dem Gehirn, kann Atrophie – zum Beispiel im Rahmen der Alzheimer-Erkrankung – zu kognitiven Defiziten, Orientierungsstörungen und Verhaltensveränderungen führen.
Muskeldystrophien sind eine Gruppe erblich bedingter, progressiver Muskelerkrankungen, die durch einen fortschreitenden Abbau, also Atrophie, von Muskelgewebe gekennzeichnet sind. Die Erkrankungen entstehen durch genetische Defekte, die zu einer Fehlfunktion oder einem Fehlen von Strukturproteinen in den Muskelzellen führen. Das Muskelgewebe wird dadurch zunehmend durch Fett– und Bindegewebe ersetzt, was zu Schwäche und Funktionseinbußen führt. Es lassen sich mehrere Formen der Muskeldystrophie unterscheiden, von denen eine sehr bekannte die des Typ Duchenne ist. Sie zeichnet sich durch einen zügigen Verlauf und eine sehr ungünstige Prognose aus. Außerdem beginnt sie schon in der frühen Kindheit.
Klinisch ist die Atrophie meist langsam fortschreitend, kann aber auch akut auftreten. Die Diagnose erfolgt durch körperliche Untersuchung, Bildgebung Laboruntersuchungen, je nach zugrunde liegender Ursache.
Häufige Fragen
- Was ist Atrophie genau?
- Was sind die Ursachen von Atrophie?
- Wie kann man Muskelatrophie erkennen?
- Was hilft gegen Muskelatrophie?
Atrophie ist der medizinische Begriff für den Rückgang oder Schwund von Gewebe, Organen oder Zellen im Körper. Dabei werden entweder die Zellen kleiner oder es geht Zellmasse ganz verloren. Das betroffene Gewebe wird dadurch dünner, leichter oder verliert seine Funktion.
Atrophie entsteht meist durch Bewegungsmangel, Durchblutungsstörungen, Mangelernährung oder Nervenschäden. Auch Hormonveränderungen, chronische Erkrankungen und das Alter können Gewebeschwund verursachen. Dabei schrumpfen Zellen oder sterben ab, weil sie nicht ausreichend versorgt oder genutzt werden.
Muskelatrophie erkennt man an sichtbarem Muskelschwund, Kraftverlust, Bewegungseinschränkungen und schnellere Ermüdung, aber auch manchmal durch Muskelkrämpfe oder Schmerzen.
Gegen Muskelatrophie helfen vor allem eine regelmäßige Bewegung und gezieltes Krafttraining, um die Muskeln zu stärken und abzubauen. Auch Physiotherapie, besonders nach Verletzungen oder bei neurologischen Erkrankungen, kann dem Prozess entgegenwirken. Ausgewogene, proteinreiche Ernährung, soll den Muskelaufbau zu unterstützen. Bei Krankheiten, die die Atrophie auslösen oder begünstigen, wäre eine Behandlung der zugrunde liegenden Ursache eine Möglichkeit.
- Lüllmann-Rauch, Renate: Taschenlehrbuch Histologie, Thieme, 6. Auflage, 2019
- Aumüller, Gerhard et al.: Duale Reihe Anatomie, Thieme, 5. Auflage, 2020