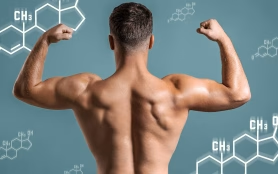Inhaltsverzeichnis
Anabol bezeichnet in der Medizin und Biologie alle aufbauenden Prozesse im Körper, etwa beim Muskelaufbau oder der Geweberegeneration. Der dahinterstehende Stoffwechselweg wird als Anabolismus bezeichnet und ist essenziell für Wachstum, Heilung und Erhalt körperlicher Funktionen. Dieser Artikel erklärt, was „anabol“ genau bedeutet, wie der Anabolismus funktioniert, welche Rolle anabole Substanzen spielen und warum diese Prozesse auch im ärztlichen und pflegerischen Alltag eine wichtige Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
Anabol – Definition und Grundlagen
Der Begriff „anabol“ stammt aus dem Griechischen („ana“ = auf, hinauf und „ballein“ = werfen) und bedeutet wörtlich „aufbauend“. In der Medizin und Biologie beschreibt anabol alle Stoffwechselprozesse, bei denen aus kleinen Molekülen größere, komplexere Strukturen gebildet werden. Diese Prozesse sind entscheidend für das Wachstum, die Zellteilung, den Gewebeaufbau und die Regeneration im menschlichen Körper.
Zur besseren Einordnung hilft der Gegensatzbegriff „katabol“. Katabole Prozesse bauen Körpersubstanz ab, etwa beim Fasten oder bei schwerer Krankheit, um Energie bereitzustellen. Anabole Prozesse dagegen verbrauchen Energie, um neue Strukturen aufzubauen. Beide Prozesse zusammen bilden den gesamten Stoffwechsel, den man als Metabolismus bezeichnet.
Typische Beispiele für anabole Vorgänge im Alltag sind folgende:
- Muskelaufbau nach sportlichem Training
- Wundheilung nach Verletzungen oder Operationen
- Wachstum in Kindheit und Jugend
- Speicherung von Nährstoffen in Form von Glykogen (Zuckerspeicher) oder Fett
Anabol – Anabolismus im menschlichen Körper
Die Vorgänge des Anabolismus laufen auf zellulärer Ebene ab und betreffen alle Gewebearten. Der Anabolismus ist notwendig für den Erhalt der Zellstrukturen, das Wachstum sowie die Erholung nach Verletzungen oder Krankheiten.
Ein zentrales Beispiel für anabole Prozesse ist die Proteinsynthese. Dabei werden einzelne Aminosäuren zu Eiweißen (Proteine) zusammengesetzt, die zum Aufbau von Muskelgewebe, Enzymen oder Zellbestandteilen benötigt werden. Weitere anabole Prozesse sind die Fettsäuresynthese, bei der aus Acetyl-CoA Fettsäuren entstehen, sowie die Glykogensynthese, bei der Stoffwechselprozesse Glukose zu Glykogen verknüpfen, dem kurz- bis mittelfristigen Energiespeicher in Leber und Muskulatur.
Alle diese Vorgänge sind energieabhängig. Die Energie wird in Form des Moleküls ATP (Adenosintriphosphat) bereitgestellt, das bei Bedarf aus den Energiespeichern des Körpers gebildet wird. Auch NADPH spielt als Reduktionsmittel eine wichtige Rolle in bestimmten anabolen Reaktionen, etwa bei der Lipidbiosynthese.
Die Regulation des Anabolismus erfolgt über körpereigene Hormone, darunter:
- Insulin, das nach Nahrungsaufnahme den Aufbau von Fett und Glykogen fördert
- Wachstumshormon (Somatotropin), das die Eiweißsynthese und das Längenwachstum von Knochen anregt
- Testosteron und Östrogene, die am Muskel- und Knochenaufbau beteiligt sind
Diese Hormone aktivieren bestimmte Signalwege in den Zellen, die zur vermehrten Herstellung von Strukturproteinen und anderen Zellbestandteilen führen. Dadurch passt sich der Körper an Belastungen an und kann beschädigtes Gewebe ersetzen.
mTOR-Signalweg
Ein zentraler Schalter für anabole Prozesse in den Zellen ist der sogenannte mTOR-Signalweg (mammalian target of rapamycin). Dieser Signalweg wird durch Hormone, Nährstoffe und körperliche Aktivität aktiviert und steuert das Zellwachstum sowie die Proteinsynthese. Er spielt eine Schlüsselrolle bei Muskelaufbau, Zellteilung und Regeneration und ist daher auch Zielstruktur in der medizinischen Forschung.
Anabol – Natürliche und künstliche Substanzen
Anabole Substanzen fördern den Aufbau von Gewebe, insbesondere von Muskel- und Knochenmasse. Dabei kann es sich um natürliche körpereigene Hormone wie Testosteron, Insulin oder Wachstumshormon handeln oder um synthetische Wirkstoffe, die strukturell an das Hormon Testosteron angelehnt sind.
Im medizinischen Kontext werden solche Substanzen gezielt eingesetzt, etwa bei Patientinnen und Patienten mit starkem Muskelabbau (Kachexie), Osteoporose oder bestimmten Formen der Blutarmut (Anämie). Ziel ist es, den anabolen Stoffwechsel zu fördern, um Kraft, Gewebe und Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Eingesetzt werden dabei unter anderem Testosteronpräparate oder synthetische anabole Steroide wie Nandrolon.
Doping und Steroide
Außerhalb der Medizin kommen anabole Steroide vor allem im Leistungs- und Kraftsport zum Einsatz, häufig ohne ärztliche Aufsicht. In diesem Zusammenhang werden sie verwendet, um schneller Muskelmasse und Kraft aufzubauen. Die Einnahme erfolgt meist in hohen Dosen und oft in Kombination mit anderen Substanzen. Dies ist mit erheblichen Risiken verbunden.
Die Nebenwirkungen eines nicht-medizinischen Gebrauchs anaboler Steroide sind vielfältig und können schwerwiegend sein. Häufig betroffen ist das Herz-Kreislauf-System. Es kann dabei zu Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und in der Folge zu Herzinfarkten kommen. Auch die Leber kann geschädigt werden, insbesondere bei oraler Einnahme, da die Substanzen dort abgebaut werden müssen.
Viele synthetische anabole Steroide wirken nicht nur muskelaufbauend (anabol), sondern auch auf die Geschlechtsmerkmale ein (androgen). Männer entwickeln mitunter eine Brustvergrößerung (Gynäkomastie), Frauen berichten von Störungen des Zyklus oder einer Vermännlichung der Stimme. Auch die eigene Hormonproduktion kann dauerhaft gestört werden, was unter anderem zu Unfruchtbarkeit führt.
Psychische Auswirkungen sind ebenfalls dokumentiert. Viele Nutzer berichten von Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, aggressivem Verhalten bis hin zu depressiven Verstimmungen. Bei längerer Anwendung kann eine Abhängigkeit entstehen.
Da anabole Steroide auf der Liste der verbotenen Dopingmittel stehen, ist ihr Besitz ohne ärztliche Verordnung in Deutschland strafbar.
Mehr Protein gleich mehr Muskelmasse?
Der gezielte Aufbau von Muskelmasse durch Eiweißzufuhr ist nur bis zu einem gewissen Maß möglich. Entscheidend ist nicht allein die Menge, sondern die Kombination aus ausreichender Proteinzufuhr und körperlicher Belastung. Studien zeigen, dass bei gesunden Erwachsenen eine Proteinzufuhr von etwa 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag das Optimum für den Muskelaufbau darstellt. Höhere Mengen führen meist nicht zu weiterem Muskelzuwachs, sondern werden metabolisch umgewandelt oder ausgeschieden.
Ohne begleitendes Training, insbesondere Widerstandstraining, bleibt der anabole Reiz gering, selbst bei hoher Eiweißaufnahme. Für gesunde Personen oder ältere Menschen mit Erhaltungsziel liegt die empfohlene Tagesmenge meist niedriger, etwa bei 0,8 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm.
Anabol – Klinische Bedeutung des Anabolismus
Der Anabolismus ist nicht nur ein biochemisches Prinzip, sondern hat direkten Einfluss auf viele klinische Situationen. Besonders in der Inneren Medizin, Intensivmedizin, Chirurgie, Onkologie und Pflegepraxis spielt er eine zentrale Rolle, da der Aufbau von Körpersubstanz oft ein entscheidender Faktor für Genesung und Überleben ist.
Eiweißzufuhr
Nach Operationen, Verletzungen oder schweren Erkrankungen braucht der Körper Energie und Baustoffe, um geschädigtes Gewebe zu reparieren. Dies gelingt nur, wenn der anabole Stoffwechsel aktiviert ist. Dabei werden Proteine, Fette und andere Zellbestandteile neu gebildet. In dieser Phase ist die ausreichende Zufuhr von Energie und Eiweiß essenziell. Studien zeigen, dass die gezielte Eiweißzufuhr auf Intensivstationen entscheidend sein kann, um Muskelmasse zu erhalten und Komplikationen zu vermeiden. Leitlinien empfehlen je nach Krankheitsstadium 1,0 bis 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag, bei bestimmten Patientengruppen auch mehr als das.
Geriatrie und Ernährungstherapie
Besonders bei älteren Menschen besteht die Gefahr einer Sarkopenie, also des altersbedingten Muskelabbaus. Die gezielte Förderung anaboler Prozesse durch proteinreiche Ernährung und Bewegung ist ein zentraler Bestandteil der geriatrischen Prävention und Therapie.
In der Ernährungstherapie, etwa bei älteren oder tumorerkrankten Menschen, ist der Erhalt oder Wiederaufbau von Muskelmasse ein wichtiges Therapieziel. Hier steht die Anregung anaboler Prozesse im Zentrum der Behandlung. Auch bei Rehabilitationsmaßnahmen, zum Beispiel nach längerer Immobilisation oder bei Pflegebedürftigkeit, ist die Förderung des Muskelaufbaus entscheidend für die Wiederherstellung der Selbstständigkeit.
In der Pflegepraxis ist es wichtig, anabole Prozesse nicht unbeabsichtigt zu hemmen. Mangelernährung, unzureichende Eiweißzufuhr oder fehlende Mobilisation können die Regeneration deutlich verzögern. Klinisch zeigen sich solche Defizite unter anderem durch verzögerte Wundheilung, Muskelschwäche oder erhöhtes Dekubitusrisiko.
Medikamente
Auch die Wirkung vieler Medikamente beeinflusst direkt oder indirekt den Anabolismus. So wirkt Insulin stark anabol, während andere Substanzen wie Glukokortikoide eher abbauende Prozesse fördern. Ein Verständnis dieser Zusammenhänge ist für Ärzte ebenso wichtig wie für Pflegekräfte, um Therapien gezielt zu steuern und Nebenwirkungen zu vermeiden.
Damit ist der Anabolismus ein zentrales Prinzip in der klinischen Medizin. Er entscheidet mit über Heilungsverläufe, Therapieerfolg und Lebensqualität.
- Morton R.W. et. al., Protein supplementation and resistance training, https://bjsm.bmj.com/... , (Abrufdatum: 07.06.2025)
- DGEM S2k-Leitlinie: Klinische Ernährung in der Intensivmedizin
- DGEM S3-Leitlinie: Klinische Ernährung in der Geriatrie
- Laplante M et. al., mTOR signaling in growth control and disease, https://www.cell.com/... , (Abrufdatum: 07.06.2025)
- Hartgens F et. al., Effects of androgenic-anabolic steroids in athletes, https://link.springer.com/... , (Abrufdatum: 07.06.2025)
- Cruz-Jentoft A.J. et. al., Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis, https://academic.oup.com/... , (Abrufdatum: 07.06.2025)